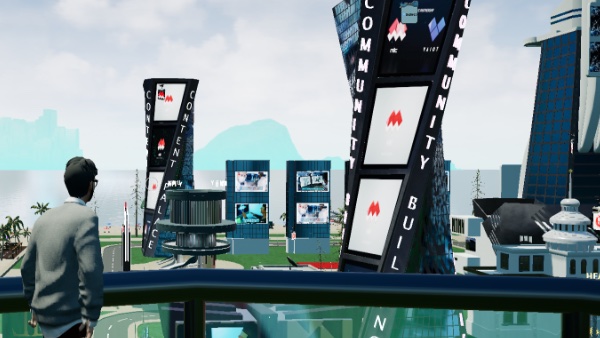Bei einem Waldspaziergang ist das Klopfen des Spechts unüberhörbar. Damit markiert das Specht-Männchen sein Revier. Vom Spätwinter bis in den April hinein versucht es mit diesem Geräusch, auch die Weibchen zu beeindrucken. Dabei hämmert es bis zu 20 Mal pro Sekunde auf den Baumstamm. Auch die Weibchen machen viel Lärm, wenn sie nach Nahrung suchen oder eine Nisthöhle bauen.
Tierforscher sind sich uneins
Selbst nach stundenlangem Hämmern zeigt der Specht keine Ermüdungserscheinungen – dabei müsste er seinem Gehirn doch beträchtlichen Schaden zufügen. Warum er dagegen immun zu sein scheint, ist sich die Wissenschaft bis heute nicht einig. Eine der gängigsten Theorien: Der Schnabel des Spechts liegt unterhalb des Gehirns. Dadurch trifft die Wucht eines Schlages nicht direkt darauf, wenn der Specht nach Nahrung sucht oder sein Revier markiert.
Sind Spechte Nutznießer der Physik?
Auch physikalische Vorgänge werden als mögliche Ursache genannt. Nach den Gesetzen der Physik muss das Spechtgehirn wegen seiner viel kleineren Abmessungen und seiner viel geringeren Masse auch viel stärkere Stöße aushalten können. Nach Berechnungen von Forschern der Universität Antwerpen bleiben die Erschütterungen beim Specht deshalb deutlich unter dem Niveau, das bei uns Schäden verursachen würde.
Ein Spechtgehirn ist winzig und wiegt nur etwa zwei Gramm. Durch die geringe Masse wird dem Gehirn beim ruckartigen Hämmern weniger kinetische Energie zugeführt – was somit das Risiko einer Hirnschädigung verringern muss.
Davon abgesehen füllt das Gehirn der Spechte fast den gesamten Schädel aus und kann beim Hämmern nicht so stark hin und her schwingen – ganz im Gegensatz zum menschlichen Gehirn. Dieses hat nämlich in einer großen Menge Hirnflüssigkeit viel Bewegungsfreiheit und kann so leicht gegen die Schädelwand prallen.
Hat der Specht einen Stoßdämpfer gegen Kopfschmerzen?
Auch die spezielle Schnabelmuskulatur des Spechts könnte eine Schutzfunktion gegen Gehirnerschütterungen übernehmen. Gemäß einer gängigen Theorie ziehen sich die Muskeln kurz vor dem Aufprall zusammen – und federn damit die bis zu 25 Kilometer pro Stunde schnellen Schläge ab.
Einige Spechtarten hämmern übrigens weniger, so macht sich der Grünspecht lieber durch Rufe bemerkbar. Der seltene Mittelspecht verzichtet sogar ganz auf das Trommelkonzert.