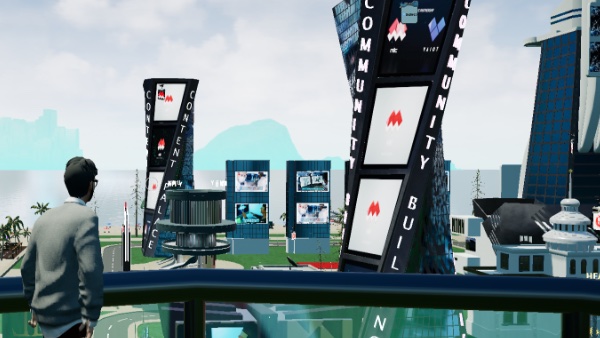Unsere Gesellschaft krankt an sozialer Kälte und Egoismus – in der Facebook-Generation auch unter dem Begriff „Kaltland“ geläufig. Das zumindest sind Dinge, die Deutschland immer wieder vorgeworfen werden. Stimmt das oder sind wir gar nicht so unsozial?
Das Land der Dichter und Denker ist gespalten wie lange nicht mehr. Auf der einen Seite erleben wir, wie andere Menschen Obdachlosen oder Flüchtlingen helfen. Doch auf der anderen Seite sehen wir leider auch, dass uns teilweise bereits die unmittelbare Umgebung immer mehr entfremdet. Menschen, die seit Jahren wortlos nebeneinander wohnen oder sich einen zermürbenden Kleinkrieg am Gartenzaun liefern.
Auch im globalen Vergleich ländertypischer Charakterzüge belegen die Deutschen nie einen der Spitzenplätze was Warmherzigkeit und Nächstenliebe angeht. Doch worum geht es beim Kaltland wirklich?
Deutschland – ein kaltes Land?
„Es ist deutsch in Kaltland“ – dieser Satz fiel in den vergangenen Jahren des Öfteren und wird gerade von der jüngeren Generation mit der Flüchtlingssituation 2015 in Verbindung gebracht. Die Wahrheit sieht aber so aus, dass der Suchbegriff bereits seit 2004 durch Googles Trends geistert. Und obschon es sich dabei um eine ziemlich simple Verkürzung handelt, trifft der Satz aus Sicht der Kritiker genau ins Schwarze: soziale Kälte, ein deutsches Phänomen.
Ganz neutral betrachtet, ist es nicht von der Hand zu weisen, dass Kaltland ein durchaus passendes Wortspiel ist. Denn ganz wertneutral steht typisch Deutsch bei vielen Menschen für:
- Humorlosigkeit
- Nüchterne Effizienz
- Leidenschaftslosigkeit
- Pedanterie
- Obrigkeitshörigkeit
In manchen Augen sind Deutsche wenig mehr als nüchterne Roboter – äußerst effektiv, aber auch mit ähnlich dünnen sozialen Fähigkeiten. Doch auch wenn diese Charakterzüge übertrieben sind, hat jedes Klischee einen wahren Kern.
Den Nachbarn als Feind
Es beginnt schon mit einer tatsächlich typisch deutschen Eigenschaft: Sich mit seinem Nachbarn nicht nur in die Haare zu kriegen, sondern jahrelange Graben- und Nervenkriege auszufechten. Fast 10.000 Fälle landen alljährlich vor Gericht. Dies ist die Folge davon, dass heutzutage praktisch jeder über eine Rechtsschutzversicherung verfügt und deshalb schneller wegen Lappalien verklagen. Doch die Ursache liegt tiefer.
Denn die große Ordnungsliebe der Deutschen, kollidiert direkt mit den unzähligen Gesetzen des Nachbarschaftsrechts. Das regelt bis ins Kleinste, was wie hoch wie dicht an der Grenze stehen darf. In der Realität bedeutet das, dass sich jede Partei im Recht fühlt und diesen Glauben buchstäblich bis aufs Messer verteidigt. Eine Politik des „leben und leben lassen“ verfolgen immer weniger Menschen.
Hier zeigt sich einer der großen Nachteile des deutschen Systems: Vergleichsweise viele staatliche Regulierungen schaffen einen Nährboden für kleinliche Menschen, die sich darauf berufen. In weniger gesetzlich einengenden Ländern würde man sich vielleicht gütlich einigen oder es würde mangels solcher Charakterzüge erst gar nicht zum Streit kommen.
Zumindest teilschuldig an der heutigen Situation ist allerdings auch die wirtschaftliche Lage der Bundesrepublik. Noch bis zur Jahrtausendwende galt hier das Prinzip der sozialen Marktwirtschaft bei der die Wirtschaft zwar frei war – gleichzeitig aber achtete der Staat darauf, das soziale Gleichgewicht zu wahren. Die Möglichkeiten, auch denen zu helfen, die weniger leisten konnten, trockneten weitestgehend aus. Gründe sind eine zunehmend globalisierte Welt, weltwirtschaftliche Einflussfaktoren und auch finanzielle Herausforderungen, die die Bundesrepublik nach der Wende zu stemmen hatte. Anfang der 2000er war Deutschland der kranke Mann Europas mit zu vielen Sozialausgaben und einer Arbeitslosenquote wie zuletzt kurz nach dem Krieg.
Die Folge: Das „sozial“ wurde weitestgehend gestrichen, übrig blieb eine Marktwirtschaft, die nur noch der Leistung huldigte. Wer nicht mitzog und zieht, steht schnell vor dem gesellschaftlichen Aus. Allerdings: Selbst im Land von Hartz-IV und Zwangsverrentung sieht es noch besser aus als an manchen anderen Orten.
Wie sieht’s anderswo aus?
Frankreich: Selbstmord in der Bannlinie
Die soziale Lage Frankreichs lässt sich am ehesten durch die trostlosen Banlieue-Siedlungen rund um die großen Städte verdeutlichen. Was nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich als modernes Wohnen für die Arbeitermassen gedacht war, wurde durch zunehmende Deindustrialisierung zum Sinnbild für Ghettoisierung, für Ausgrenzung und Perspektivlosigkeit. Heute leben knapp zehn Prozent aller Franzosen in diesen Betonsiedlungen, in denen zur räumlichen Enge auch noch mangelnde Arbeitsmarktchancen kommen und zu einem explosiven Pulverfass werden.
Italien: Der Anti-Sozialstaat
So wie Italien große Probleme mit staatlichen Gebieten wie der Müllabfuhr hat, sieht es auch auf dem Gebiet der Sozialversorgung aus. Hart ausgedrückt gibt es praktisch kein System der Arbeitslosenunterstützung, wie wir es kennen. Weder existiert dort eine Grundsicherung, noch gibt es Fortbildungsmaßnahmen oder alternative Jobangebote. Um all das, was in Deutschland das Arbeitsamt erledigt, müssen sich Italiener – groß angekündigter Reformen zum Trotz – selbst kümmern.
USA: Stadt vs. Land
Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten ist der Gegenpol zum deutschen Big State. Es existieren viel weniger Gesetzeshürden. Gleichzeitig gibt es in den USA aber auch extreme soziale Gegensätze. Hier die Superreichen, dort die Obdachlosen, oftmals Veteranen, die durchs soziale Raster gefallen sind.
Schuld ist hier, besonders in Sachen Arbeitslosenversicherung, die Zerstückelung der Zuständigkeiten auf die Einzelstaaten. Das bedeutet, dass unter Umständen im einen Staat mehr und länger Arbeitslosenhilfe gezahlt wird, während man nach Jobverlust im nächsten Staat buchstäblich schnell auf der Straße sitzt.
Außerdem ist die amerikanische Mentalität, für sich selbst verantwortlich sein zu wollen, extrem tief ausgeprägt, sodass es keine große Mehrheit gibt, etwas an diesen Zuständen zu ändern. Obendrein herrscht zwischen Atlantik und Pazifik ob der räumlichen Distanzen auch eine scharfe Grenze im Kopf zwischen Städtern und Landbewohnern, die für Unversöhnlichkeit sorgt.
England: Obdachlos trotz Arbeitsplatz
Doch man muss nicht über den großen Teich fliegen, um zusehen, dass selbst der vielgescholtene deutsche Sozialstaat bei genauerer Betrachtung in Ordnung ist. Denn gerade in Großbritannien, wo sich die Arbeitsmärkte eng ballen, ist das Sozialsystem ähnlich überfordert, wie in der Bundesrepublik anno 2000.
Obendrein sind die Lebenshaltungskosten in den wirtschaftlichen Zentren extrem hoch. Für ein WG-Zimmer in London gibt man schnell 1.000 Pfund, also umgerechnet knapp 1.200 Euro, monatlich aus. Die Folge: Die Obdachlosigkeit in der Hauptstadt steigt alarmierend, selbst unter denen, die eigentlich gute Jobs haben.
Woran liegt es?
Diese Beispiele zeigen, dass soziale Kälte beileibe kein singulär deutsches Phänomen ist. Praktisch in jedem Erstweltland sieht es so aus. Doch die Gründe ähneln sich trotz aller kulturellen Unterschiede immer.
Auch wenn man über Kapitalismuskritiker geteilter Meinung sein kann, stimmt zumindest einer ihrer Kritikpunkte. Denn in der heutigen Welt wird überall Wachstum gepredigt und als Eichmaß der Zivilisation angesehen. Jedes Land steht mit jedem anderen in Konkurrenz im Kampf um Gewinne, Profitmaximierung und Ausstöße. Allerdings funktioniert das Ellbogendenken am Arbeitsplatz nicht nur aus Abstiegsangst, sondern auch aus Aufstiegssucht. Karriere im Beruf ist einem Großteil der Arbeitnehmer wichtig bis sehr wichtig. Mehr Gehalt, mehr Prestige, mehr Verantwortung locken viele.
Generation Egoist
Mittlerweile hat dieses Erfolgsdenken soweit um sich gegriffen, dass es in Deutschland derzeit knapp drei Millionen Studierende gibt, 2016 aber nur 510.900 neue Ausbildungsverträge abgeschlossen wurden. Selbst wenn man diese Zahl wegen der typischen Ausbildungsdauer von drei Jahren entsprechend hochrechnet, zeigt sich immer noch, dass das Ansehen von Berufen, die kein Studium erfordern, derzeit historisch niedrig liegt. Und damit vertieft sich gleichsam die Kluft zwischen Hochschulabsolventen und den Ausgebildeten.
Gleichsam ist der heutige Mensch eine interessante Mischung zwischen Individualist und Herdentier: Unbewusst möchte sich jeder vom Rest absetzen – sei es durch Kleidung, Haarschnitt oder materielle Güter. Grundsätzlich ermöglicht wird das aber erst durch die heute gigantischen Angebotspaletten, die es gestatten, durch Waren Individualität zu erkaufen. Gleichsam stehen zu extreme Individualisten aber auch schnell jenseits der Gesellschaft – welche Firma mit stetem Kundenkontakt würde beispielsweise jemanden einstellen, der großflächige Tätowierungen im Gesicht hat? Andere versuchen sich mit sozialem Aufstieg, mehr Geld und mehr Ansehen abzugrenzen. Das wiederum sorgt – neben der sozialen Komponente – für weiteres Ellbogendenken. Man möchte sich ja von den Nachbarn, den Kollegen, den Freunden als Individualist abheben – sei es via Beförderung, neuem Auto oder renoviertem Wohnzimmer.
Jeder eine einzigartige Schneeflocke
Dank des Individualitätsdenkens hält sich jeder mehr oder weniger für etwas ganz Besonderes. Daran ist primär nichts falsch, denn schließlichist jeder Mensch schon durch seinen freien Willen ein Individuum. Kritisch ist die Ansicht, dass die Gesellschaft dieser Individualität einen irgendwie gearteten Tribut zollen müsse. Durch viele Beispiele belegt, findet sich die wissenschaftliche Erforschung des sogenannten Special Snowflake Syndromsallerdings noch in den Anfängen.
- Das grassierende Phänomen der Helikopter-Eltern, zu dem auch der Glaube gehört, dass das eigene Kind unfair von den Lehrern behandelt würde.
- Das Einfordern von Sonderbehandlungen aufgrund eigentlich nichtiger Anlässe.
- Das Überhöhen von eigenen Gefühlen gegenüber anderen.
- Der Mangel an Einfühlungsvermögen anderen Ansichten gegenüber.
Es steht also zumindest in der Vermutung, dass der ungebremste Wunsch nach Individualität tatsächlich dazu führt, dass die Menschen immer Ich-bezogener werden, keine guten Aussichten für die Zukunft.
Gleichzeitig kommt auch noch eine weitere Komponente hinzu: In dieser Mixtur zwischen
- Sozialangst,
- Leistungszwang,
- Ellbogendenken
- und Egoismus
bleibt schlicht kaum noch Zeit dafür, sich zwischenmenschlich mit anderen zu befassen.
Besonders gravierend wird dieser Zeitmangel in der Familie. Die Zahl der Eheschließungen ist seit Jahren zumindest konstant, die Zahl der Scheidungen auch. Über Beziehungen, die aufgrund des Zeitgeists beendet werden, kann man nur spekulieren.
Die hohe Trennungsrate bei Ehen oder Beziehungen lässt sich darauf zurückführen, dass heute aus Zeitmangel und Egoismus vielen schlicht die Geduld fehlt, sich mit Problemen tiefer auseinanderzusetzen und sie zu reparieren. Im Zweifelsfall wird die Partnerschaft dann eher beendet. Die Zahl der Singles steigt nämlich seit Jahren ungebrochen.
Ein weiteres Phänomen ist wiederum „typisch Deutsch“. Denn grob ausgedrückt herrscht hier eine Neidkultur. Wenn jemand anderes etwas Besseres besitzt, reagieren Deutsche eher neidisch darauf – wohingegen in anderen Ländern Lob und Anerkennung die Reaktionen sind.
Und einmal mehr muss das deutsche Sozialsystem betrachtet werden. Denn die Agenda 2010 hat einem Volk, das jahrzehntelang vergleichsweise sicher lebte, den Boden unter den Füßen weggezogen. Nach einem oder bestenfalls zwei Jahren Arbeitslosengeld winkt Hartz-IV. Mit dieser Unsicherheit eines jeden Arbeitnehmers lässt sich kein Sozialgefüge verbessern. Selbst die Agenda-ideengebende SPD hat das erkannt, Martin Schulz macht Wahlkampf damit, zu korrigieren.
Und wo ein Arbeitsplatz dank Hochleistungsdenken und Outsourcing im Nu verschwinden kann, herrscht auch bei denen Panik, die durch die Ausbildung sicher sein müssten. Ein weiterer Nagel im Sargdeckel des Sozialdenkens.
Das „Like“ ersetzt den Händedruck
Über die sozialen Netzwerke sind wir heute so eng miteinander verknüpft wie nie zuvor – und gleichzeitig so weit entfernt. Es gibt heute Menschen, deren kompletter Freundeskontakt sich nur noch virtuell abspielt. Man kann anderen jedes Detail seines Lebens zugänglich machen, doch statt richtiger Gespräche gibt es ein Like oder wahlweise ein Lach-Emoji. Hier ersetzt der Klick auf den Freunde-entfernen-Button das klärende Gespräch bei Streits. Wir verlieren also immer mehr die Fähigkeit zur echten Kontaktpflege.
„Je suis Charlie“ – die Web-Informationsflut bringt uns nicht nur Nachrichten im Sekundentakt, sondern stumpft immens ab. Wenn in den 80ern der Bus eines Erstliga-Fußballvereins mit Sprengkörpern angegriffen worden wäre, hätte das Thema wochenlang die Schlagzeilen beherrscht. Heute ist die Attacke auf den BVB-Bus schon nach einer Woche fast gänzlich aus den großen Nachrichtenportalen verschwunden. Das Netz überflutet uns regelrecht mit allen möglichen Meldungen. Und wir reagieren ganz menschlich: Wir blenden irgendwann selbst Horrormeldungen aus. Zusammen wird daraus eine anonyme Masse: Man gibt sein Like für dieses, kommentiert jene Meldung, doch in Wahrheit bewegt man sich wie hinter Glas „ist nicht mir passiert, kann abgehakt werden“. Die sozialen Netzwerke machen ihre User eher unsozial und fördern Einzelgänger und damit auch den Hang zur Special Snowflake.
Es steht außer Frage, dass wir tatsächlich breitgesellschaftlich egoistischer und unsozialer werden – Ausnahmen bestätigen die Regel – doch dies zu korrigieren, ist eine Mammutaufgabe, sowohl für den Einzelnen, als auch die Politik.
Raus aus der Ich-Zentriertheit
Zunächst einmal sollte man nicht glauben, dass man nur wegen seines Status als Individuum eine Sonderbehandlung verdiene. Denn obschon wir alle individuell sind, gehören wir doch zu einer Gruppe und in der ist keiner mehr oder weniger wert. Und erst recht definiert sich der Wert eines Menschen nicht durch vermeintliche Gefühlslagen.
In einem solchen Kontext gehört es auch dazu, nicht in jedem einen potenziellen Konkurrenten zusehen. Der Kollege hat nicht unbedingt ein besseres Standing als man selbst. Ihm den Ellbogen ins Gesicht zu knallen, nur um beim Chef besser dazustehen, ist nicht nur in höchstem Maß unsozial, sondern führt meist auch zu nichts – außer, dass jeder des anderen Teufel ist.
Ähnlich sieht es auch in anderen Bereichen aus. Nur weil man eine Rechtschutzversicherung hat, muss man dem Nachbarn nicht gleich den Anwalt an den Hals hetzen, nur weil dessen Tomaten durch den Zaun wuchern. Obendrein müssen wir alle lernen, in den Erfolgen unserer Mitmenschen nicht das Negative für uns zu sehen, sondern das Positive für sie:
- Der Nachbar hat ein neues Auto, ich freue mich, denn sein Altes war eine dauerkaputte Rostlaube.
- Mein Cousin wird endlich Vater, bei uns klappt es sicher auch bald.
- Ein Kollege hatte fünf Richtige im Lotto, genial, hoffentlich gönnt er sich was Schönes davon.
Natürlich ist es schwer, in solchen Lagen keinen Neid zu entwickeln. Aber man kann sich damit helfen, indem man sich vor Augen hält, dass Neid einen vergiftet. Mitfreude hingegen macht indes glücklich.