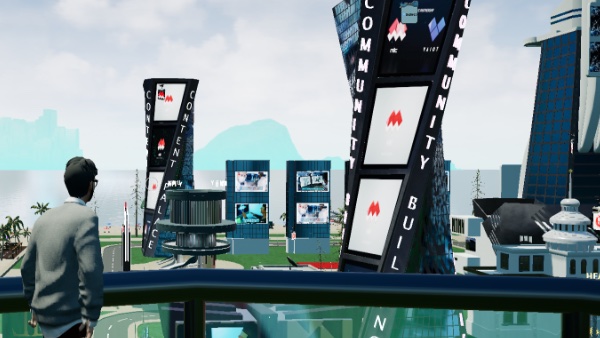Die Entstehung der Bauernregeln
Für alle Menschen hat das Wetter eine große Bedeutung. Was zieht man an, wie fährt man in die Arbeit und wann am besten in den Urlaub? Doch für eine Berufsgruppe war und ist es auch heute noch von existenzieller Wichtigkeit: Für Bauern entscheidet das Klima über Erfolg oder Misserfolg bei der Ernte. Daher beobachteten sie das Wetter schon vor Jahrhunderten sehr genau und leiteten daraus ihre Bauernregeln ab.

Schafskälte
Die sogenannte Schafskälte um den 11. Juni herum tritt mit 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit ein: Nach der ersten warmen Witterungsperiode Ende Mai bringt kalte Polarluft Temperaturstürze von fünf bis zehn Grad. Der Begriff kommt daher, dass die Schafe zu diesem Zeitpunkt meist schon geschoren sind und die Kälte für sie gefährlich werden kann.

Altweibersommer
Dieser Begriff hat mit älteren Frauen nichts zu tun: Als „weiben“ wurde im Altdeutschen das Knüpfen von Spinnweben bezeichnet. Gibt es von Mitte bis Ende September eine Schönwetterperiode, sieht man morgens in der Sonne oft besonders viele von Tau überzogene Spinnennetze. Der Altweibersommer ist recht zuverlässig: Tatsächlich gibt es fast jedes Jahr um diese Zeit eine beständige Hochdruckwetterlage.

April, April
„April, April, der macht, was er will“: Diese Bauernregel ist wohl eine der bekanntesten – und verdankt dies vermutlich unter anderem der Tatsache, dass der April meist wirklich sehr wechselhaft ist. Der Grund dafür: Die Temperaturunterschiede zwischen Meer und Land in diesem Monat sind noch recht groß. Je nach Windrichtung setzt sich kalte oder warme Luft durch.

Ein wahrer Kern
Laut dem Deutschen Wetterdienst haben Bauernregeln tatsächlich oft einen wahren Kern. Dennoch sind sie nicht so zuverlässig wie offizielle Wettervorhersagen – schon allein deshalb, da die Wetterregeln von der Region abhängen, in der sie aufgestellt wurden.

Eisheilige
„Vor Bonifaz kein Sommer, nach der Sophie kein Frost“: Als Eisheilige Mamertus, Pankratius, Servatius, Bonifatius und kalte Sophie werden die Tage vom 11. bis 15. Mai bezeichnet. In dieser Zeitspanne soll die letzte Gefahr für Nachtfrost herrschen. Vorher ist die Aussaat von kälteempfindlichen Pflanzen nicht empfehlenswert – zumindest besagt dies die Bauernregel ...

Hundstage
Laut einer alten Bauernregel sollen die Hundstage, die in der Zeit zwischen dem 23. Juli und dem 23. August liegen, schwüles Wetter und Hitze versprechen. Mit Hunden hat dies jedoch nichts zu tun: Der Begriff leitet sich vom Stern Sirius ab, der auf Deutsch Hundsstern heißt. Dieser ist zwischen Ende Juli und Ende August der Sonne am nächsten. Statistiken zeigen jedoch für diesen Zeitraum eher unbeständige Wetterlagen.

Mariä Lichtmess
„Ist’s an Lichtmess hell und rein, so wird‘s ein langer Winter sein. Wenn es aber stürmt und schneit, ist der Frühling nicht mehr weit“: Am 2. Februar begann traditionell für die Bauern das neue Arbeitsjahr. Ist an diesem Tag schönes Wetter, soll es auch laut dem Meteorologen Dr. Jurik Müller mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa siebzig Prozent bis Ende März übermäßig viele Frosttage geben.

Morgen- und Abendrot
„Abendrot – Gutwetterbot, Morgenrot schlecht Wetter droht“: Diese Bauernregel kennt fast jeder und sie stimmt für unsere Breiten meist. Der Grund: Westwinde bestimmen hier das Wetter. Abendrot entsteht, wenn der Himmel im Westen klar ist und sich die Wolken im Osten befinden. Diese ziehen über Nacht aufgrund des Westwindes dann ab und der nächste Tag wird sonnig. Bei Morgenrot ist es umgekehrt: Die Sonne steht im Osten und die Bewölkung im Westen zieht im Laufe des Tages auf.

Nicht alles glauben
Auch wenn viele Bauernregeln ihre Berechtigung haben, kann man jedoch nicht alle glauben. Sätze wie „Wenn viel Gras die Hunde fressen, wird es bald vom Himmel nässen“ oder „Gründonnerstagsregen gibt selten Erntesegen“ können nach logischen Gesichtspunkten nicht stimmen: Hunde fressen – wetterunabhängig – Gras zur Anregung der Verdauung und der Gründonnerstag kann auf 35 verschiedene Tage fallen ...

Siebenschläfer
„Das Wetter am Siebenschläfertag sieben Wochen so bleiben mag“: Diese und ähnliche Bauernregeln rund um den 27. Juni besagen, dass das Wetter an diesem Tag für die nächsten sieben Wochen und damit für den restlichen Sommer so bleibt. Statistische Auswertungen zeigen, dass die Siebenschläfer-Regel mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 bis 70 Prozent eintritt.