Wie uns das Gehirn überlistet
Die Ursache für diese Täuschung liegt in unserem Gehirn. Nimmt es etwas in unserem Blickfeld nur unvollständig oder diffus wahr, ergänzt es die Wahrnehmung. Die aufgenommene visuelle Information wird so angepasst, dass sie einem vertrauten Bild entspricht. Pareidolien sind also Fehlinterpretationen durch unsere grauen Zellen.
Von Halluzinationen unterscheidet sich die Pareidolie dadurch, dass wir sie bewusst steuern können. Unser Gehirn verleiht uns auf diese Weise auch die Fähigkeit, zum Zeitvertreib Tiere in Wolkenbänken oder schlafende Riesen in großen Gebirgsketten zu sehen.
Die Ursache liegt in der Evolution des Menschen
Allerdings kommt der Erkennung von Gesichtern eine Sonderstellung zu. Forscher des Instituts für Technologie in Massachusetts haben herausgefunden, dass unsere linke Hirnhälfte analytisch beurteilen kann, wie ähnlich ein Bild einem Gesicht ist. Die rechte Hemisphäre des Gehirns entscheidet dann innerhalb von kurzer Zeit, ob wir wirklich ein Gesicht vor uns haben.
Der Ursprung des Phänomens ist wahrscheinlich evolutionär begründet. Schließlich sind Gesichter das eindeutige Erkennungszeichen eines Menschen. Ein menschliches Gesicht als solches zu identifizieren, kann für Säuglinge und Kleinkinder überlebenswichtig sein. Im späteren Leben hilft es Menschen dabei, Personen in unübersichtlichen Situationen schnell zu erkennen. Und auch diese Fähigkeit kann uns in gefährlichen Situationen wichtige Hilfe leisten.
So bekommt die Stadt neue Gesichter
Manche Künstler nutzen das Phänomen der Pareidolie für das sogenannte Eyebombing – sie bekleben alltägliche, eigentlich reizlose Objekte mit Augen. Ihr Ziel: Die Gegenstände zu vermenschlichen. Einer der bekanntesten Künstler dieser Strömung ist Vanyu Krastev. Der Fotograf verschönert die Straßen in der bulgarischen Hauptstadt Sofia.

Der bulgarische Künstler Vanyu Krastev verleiht in seiner Street-Art-Fotografie alltäglichen Objekten aus gewöhnlichen Großstadtumgebungen Gesichter. Diese Mülltonne scheint sich sehr zu freuen!

Auf diese Weise verwandelt er graue, monotone Stadtszenen in oft lustig anzusehende Kunstwerke.

Kleine, comicartige Augen zum Aufkleben, Kreativität und ein gutes Auge ist alles, was er daür benötigt.

Unbelebte Dinge bekommen auf diese Weise ein Gesicht – und somit einen ganz eigenen Charakter.

Es geht Vanyu Krastev laut eigenen Aussagen darum, das Schöne im Alltäglichen zu sehen.

Der Künstler ist in seiner Heimatstadt Sofia aktiv. Zu spät, Schornstein! Wir haben dich schon gesehen!

Krastev möchte mit seiner Kunst ein Lächeln auf unser eigenes Gesicht zaubern.

Hier haben wir etwa das Gefühl, wir werden von einem Begrenzungspfahl beobachtet.

Dieses Astloch schaut auf einmal ziemlich geschockt.

Die Idee für diese Art von Street-Fotografie kommt aus Dänemark.

Als Begründer des „Eyebombing“ gelten die Künstler Kim Nielsen und Peter Dam aus Kopenhagen.

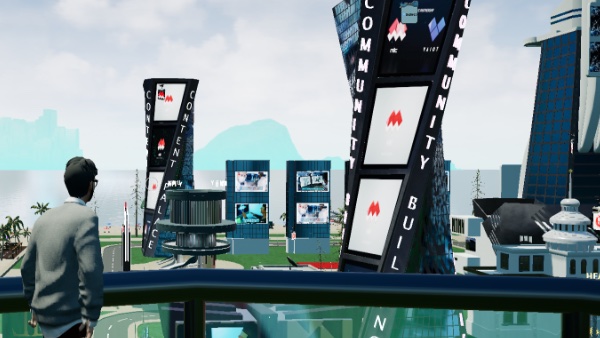
Weitere Empfehlungen der Redaktion
Sieben Tipps für mehr Leistung beim Sport
Warum es so schwierig ist, richtig zu essen
Dabeisein ist alles: Diese Disziplinen waren einst olympisch
Fanpost für den Massenmörder: Wer sind die Groupies der Schwerverbrecher?
Kann eine Insel die gesamte Menschheit auslöschen?
Wüste: blühendes Leben in totem Gelände