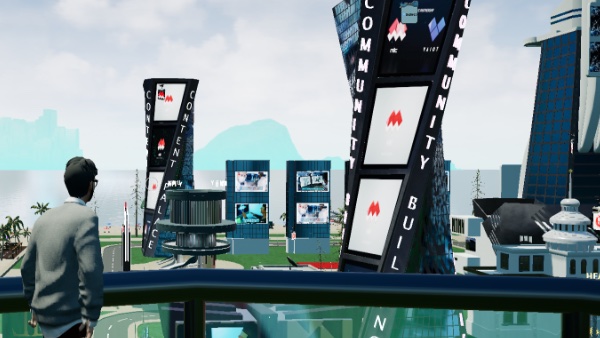„Mein Haus, mein Auto, mein Boot“ – zack, da knallen die Fotos auf den Tisch. Kaum jemand, der sich nicht an diese Werbung aus den Neunzigerjahren erinnert. Zwei Männer, seit der Schulzeit haben sie sich nicht mehr gesehen, treffen sich zufällig in einem Lokal und übertrumpfen sich mit ihren Erfolgen. Das Ziel: Neid wecken. Und das funktioniert ganz einfach. Drei Bilder von Statussymbolen, schon wird der Gegenspieler grün vor Neid.
Neid entsteht, wenn wir uns unterlegen fühlen
Der Spot ist in wenigen Sekunden erzählt. Doch die Geschichte dahinter ist Jahrtausende alt. Menschen waren schon immer neidisch aufeinander. Will man etwas über die Geschichte des Gefühls erzählen, kann man buchstäblich bei Adam und Eva anfangen: Deren Sohn Kain wurde aus Neid zum Mörder. Er erschlug seinen Bruder Abel, weil Gott dessen Opfergaben vorzog.
Im Christentum zählt Neid deshalb zu einer der sieben Todsünden. Bei den Griechen in der Antike wiederum waren nicht einmal die Götter frei von Missgunst: Die Menschen lebten in permanenter Angst, sich ihren Neid zuzuziehen. Ethnologische Studien zeigen, dass einfachste Naturvölker, überall auf der Welt, Wörter für Neid kennen. Und sogar Hunde können neidisch aufeinander sein, wie eine Studie der Universität Wien herausfand.
Nur: Woher kommt das? Warum missgönnen wir anderen Dinge, die wir selbst nicht haben können? Die Sozialpsychologen Jan Crusius und Thomas Mussweiler glauben, dass dieses Gefühl tief ins uns verankert ist: „Neid ist eine natürliche und spontane Reaktion bei Unterlegenheit.“ In einer Studie gelang es den beiden Wissenschaftlern, ihre Probanden allein dadurch neidisch aufeinander zu machen, dass sie ihnen unterschiedliche Süßigkeiten reichten.
Diejenigen, die nur einen trockenen Keks bekamen, wurden neidisch auf ihre Konkurrenten, die einen Schokoriegel erhielten. Schon mit einer solchen Lappalie ließ sich künstlich Neid erzeugen. Und das zeigt auch: In dem Moment, wo zwei Menschen sich miteinander vergleichen können, entsteht zwangsläufig Neid – selbst, wenn wir es gar nicht wollen.
Was hat er, was ich nicht habe?
Neid bezeichnen wir als Gefühl, aber streng genommen ist er eine Mischung aus mehreren Gefühlen. Im Neid stecken Traurigkeit, Wut, oft auch Verachtung, Selbstmitleid oder Angst. Eine „feindliche Gesinnung“ meint das althochdeutsche Wort „Nid“, von dem „Neid“ vermutlich abstammt. Auf Gemälden oder Kupferstichen sieht man Neider oft mit schmalen Augen und zusammengezogenen Brauen, finster zur Seite blickend. Tatsächlich heißt Neid im Lateinischen „invidia“, also „Hinsehen“. Quasi der „böse Blick“, der heute noch in vielen Kulturen gefürchtet ist.
Rolf Haubl, Professor für Soziologie und psychoanalytische Sozialpsychologie an der Uni Frankfurt, erklärt, was dabei mit uns geschieht. Er unterscheidet zwischen dem realen Selbst („so bin ich“) und dem idealen Selbst („so möchte ich sein“). Beide tragen wir in uns. Haubl sagt: Was uns zum idealen Selbst fehlt, erleben wir als Mangel, und in der Folge verwenden große Anstrengung darauf, diesen Mangel auszugleichen. Hat nun ein anderer Mensch etwas von dem, wonach wir uns sehnen, vielleicht sogar ganz ohne Anstrengung, dann weckt das Neid in uns. Wir setzen den anderen mit unserem idealen Selbst gleich.
Aber: Um materielle Güter geht es dabei meist gar nicht. Der österreichische Psychoanalytiker und Neidforscher Ulf Lukan sagt: „Wenn ich neidisch auf das neue Auto meines Nachbars bin, geht es nicht um das Auto. Ich stelle mir vor, wie toll der Nachbar sich darin fühlt – und dieses Gefühl will ich auch haben.“ Der Mangel, den wir ausgleichen wollen, ist also vielmehr ein emotionales Defizit.
Einsam und innerlich vergiftet
Neid ist sogar körperlich spürbar – als „Stich in der Brust“ etwa, als bohrendes oder auch nagendes Gefühl. Gelb oder grün vor Neid werden, sagt man auch. Der Ausdruck geht zurück auf die antike Temperamentenlehre.
Man glaubte damals, der Neid säße in der Galle. Wer neidisch war, produzierte zu viel Gallenflüssigkeit, das Gefühl vergiftete Körper und Geist. Heute weiß man zwar, dass Neidgefühle wahrscheinlich im sogenannten ventromedialen präfrontalen Cortex entstehen, einem Teil des Frontallappens der Großhirnrinde. Doch die Vorstellung einer körperlichen Vergiftung hat sich im Sprachgebrauch erhalten, auch zum Beispiel in dem Ausdruck „von Neid zerfressen sein“. Dass das Gefühl nicht oder nur heimlich ausgelebt werden darf, trägt sicher dazu bei. Denn Neid ist ein gesellschaftliches Tabu – der Neider bleibt allein mit seinen belastenden Emotionen, und das kann das Immunsystem beinträchtigen oder sogar krank machen.
Gab es Neid zwischen Menschen schon immer, so hat sich etwas anderes ständig geändert: Worum wir einander beneiden. Früher ging es dabei meist um den Erhalt der Existenz. Ein Bauer neidete dem anderen die bessere Ernte für den Winter, eine kinderlose Mutter der Nachbarin die Söhne. In unserer heutigen Konsumgesellschaft sind es eher Statussymbole, die Neid hervorrufen. Das größere Auto, der schicke Mantel, ein besserer Job, die tolle Reise – hat ein anderer etwas, was wir nicht haben, fühlen wir uns minderwertig und empfinden die Welt als ungerecht. Und soziale Netzwerke wie Facebook fördern den Vergleich mit anderen. In einer Studie der Humboldt-Universität zu Berlin gab von sechshundert Befragten jeder Dritte zu, dass er sich vor und nach der Nutzung neidisch gefühlt habe.
Kein Wunder: Am leichtesten empfinden wir Neid gegenüber Menschen, die uns nahestehen. Einer guten Freundin, die eine Reise gewinnt, missgönnen wir ihr Glück eher als einem Unbekannten, über den wir in der Zeitung gelesen haben. Denn: Haben wir eine ähnliche Ausgangssituation, erscheinen uns kleine Unterschiede viel bedeutender. Psychologen glauben, dass dieses Gefühl aus früher Kindheit stammt – wenn wir mit den Geschwistern um die Aufmerksamkeit der Eltern konkurrieren müssen. „Nähe fördert Neid, Distanz reduziert ihn“, sagt Ulf Lukan.
Jeder Mensch ist auf seine Art neidisch
„Mitleid bekommt man geschenkt, Neid muss man sich verdienen“ – so geht ein bekanntes Zitat von dem Fernsehmoderator Robert Lembke. Tatsächlich aber trifft Neid längst nicht nur erfolgreiche Menschen. Wer viel Geld verdient, arbeitet oft auch viel und neidet dann einem Müßiggänger seine freie Zeit. Studien zeigen, dass Neid völlig unabhängig von der Größe oder dem Wert eines Objektes ist. Er wird subjektiv empfunden und hängt von unseren individuellen Werten ab. So können wir anderen auch ein intaktes soziales Netzwerk missgönnen oder ihr Talent zum Klavierspiel, ihre Zielstrebigkeit im Leben oder einfach nur die schönere Haarpracht. „Sag mir, was dich neidisch macht, und ich sage dir, wer du bist“, schreibt der US-amerikanische Autor Joseph Epstein.
Für den Neid spielt es keine Rolle, wie groß die Ungleichheit zwischen zwei Menschen objektiv gesehen ist. Dem Neider erscheint das Gefälle riesig. Die Kehrseite der Medaille, dass der Beneidete für sein Glück auf einen Seite Nachteile auf der andere Seite in Kauf nehmen muss, sieht der Neider nicht. So sagt ein altes Sprichwort: „Neid macht aus niederen Halmen hohe Palmen.“ Psychologen glauben deshalb auch, dass Menschen mit niedrigem Selbstwertgefühl besonders anfällig für Neid sind.
Und die Ergebnisse einer Studie der Universität Haifa legen noch einen anderen Grund nahe, warum manche Menschen neidischer sind als andere: Das als „Kuschelhormon“ bezeichnete Oxytocin, das eigentlich für die Bindung zwischen Mutter und Kind sorgt und luststeigernd wirkt, scheint auch Neidgefühle zu verstärken. Die Psychologin Simone Shamay-Tsoory und ihr Team konnten in einem Versuch zeigen, dass Testpersonen, die Oxytocin eingenommen hat, bei einem Glücksspiel wesentlich neidischer auf die Gewinner waren als die Kontrollgruppe, die nicht unter dem Einfluss des Hormons stand.
Hinzu kommt: Neid ist nicht gleich Neid. Neidforscher Rolf Haubl unterscheidet gleich mehrere verschiedene Formen des Gefühls. So kann Neid zum Beispiel depressiv-lähmend daherkommen – wenn jemand in Selbstmitleid versinkt, weil er nie das erreichen kann oder haben wird, was ein anderer hat. Neid kann aber auch „empört rechtend“ sein – so wird in der Fachsprache ausgedrückt, dass der Neider glaubt, er habe einen Anspruch auf das Gut und die Verteilung in Frage stellt. Im schlimmsten Fall kann Neid feindselig-schädigend wirken – dann fängt jemand an, anderen bewusst zu schaden, weil sie in seinen Augen zu gut dastehen.
Eine Studie der beiden Wirtschaftswissenschaftler Daniel Zizzo und Andrew Oswald von der Universität Warwick konnte diesen feindselig-schädigenden Neid eindrucksvoll nachweisen. Für ihr Experiment ließen die beiden Forscher Testpersonen an einem Glücksspiel am Computer teilnehmen.
Es gab unterschiedlich hohe Gewinne – wer wie viel geschafft hatte, wurde den Probanden auf dem Bildschirm angezeigt. Am Ende des Spiels hatten die Spieler die Möglichkeit, mit einem Teil ihres Gewinnes höhere Gewinne anderer Teilnehmer zu zerstören. Damit standen die Gewinner am Schluss nicht besser da. Zwei Drittel der Testpersonen machte von dieser Möglichkeit Gebrauch.
Vorteile eines miesen Gefühls
Aber Neid hat auch eine gute Seite: Er kann ehrgeizig-stimulierend sein. Das ist die positive Form des Gefühls: Wenn wir jemanden ehrlich bewundern und der Neid uns motiviert, es dieser Person gleichzutun.
Im Beruf zum Beispiel oder auch im Sport kann Neid uns dann zu Höchstleistungen anstacheln: Na warte, das kann ich auch! Aus destruktivem Neid wird dann konstruktiver Neid. Die US-Forscherin Sarah Hill fand heraus, dass Neid kurzfristig die Konzentration steigern kann. Und nicht zuletzt kann Neid wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung werden. Durch ihn lernen wir, uns selbst realistisch einzuschätzen und von anderen abzugrenzen – ein Stück Selbsterkenntnis.
Was also tun, wenn sich der Neid mal wieder meldet? Das Tabu brechen, die miesen Gefühle einfach mal offen zugeben? „Neid gilt immer noch als Charakterfehler“, sagt Ulf Lukan. „Aber Leugnung ist nie gut. Es wäre schön, wenn wir differenzierter damit umgehen könnten.“
Sich den Neid selbst einzugestehen kann ein erster Schritt sein: spüren, was er uns sagen will, Lösungen dafür finden, und versuchen, negativen Neid in positiven Neid umwandeln. „Wir können uns dann zum Beispiel fragen: Warum ärgert mich das so? So kann ich herausfinden, ob in meiner Lebensführung etwas nicht stimmt“.
Nicht immer lässt sich Neid so besiegen. Rolf Haubl unterscheidet deshalb zwischen einem „aufhebbaren“ und einem „unaufhebbaren“ Mangelgefühl. Manche Dinge im Leben können wir nie erreichen. Dann hilft nur eins: die innere Einstellung zum Neid zu verändern und sich von manchen Wünschen zu verabschieden. „Zu diesem Zweck muss ein Trauerprozess in Gang kommen“, sagt Haubl. „Nicht selten macht erst eine gewonnene echte Bescheidenheit die Wahrnehmung frei.“ Das heißt: Akzeptieren, dass es nie was werden wird mit Hollywood, Nobelpreis und Yacht – und dann wieder auf andere, eigene Dinge konzentrieren.