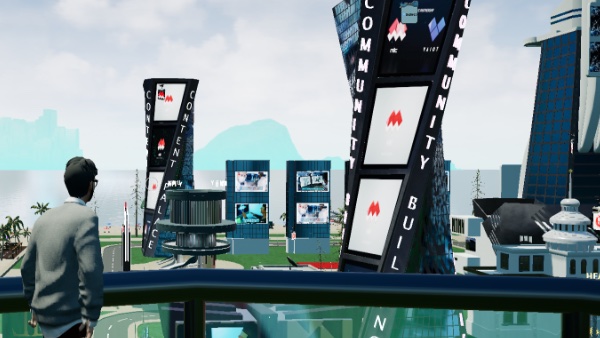Als die Schildbürger ein Rathaus bauen, stehen sie plötzlich vor einem Rätsel: In ihrem neuen Gebäude ist es stockfinster – dabei scheint draußen die Sonne! Verzweifelt versuchen sie, Licht in Säcken und Eimern ins Rathaus zu schaffen, doch ohne Erfolg. Erst als einer von ihnen einen Riss in der Mauer entdeckt, wird ihnen klar, was sie vergessen haben: die Fenster.
Diese ist nur eine von vielen märchenhaften Geschichten über die einfältigen Schildbürger. Das Buch, in dem sie erschienen sind, stammt aus dem Jahr 1598 und war damals ein Bestseller. Mehrere Autoren erzählen darin Begebenheiten von den Bürgern eines Ortes namens Schilda. Seine Einwohner haben einen noch schlechteren Ruf als die Ostfriesen, über die es heute unzählige Witze gibt. Trotzdem oder vielleicht gerade deshalb wurden ihre Geschichten so gerne gelesen. Über andere zu lachen entlastet – denn offensichtlich gibt es immer noch jemanden, der dümmer ist als man selbst.
Das Leid der Klugen
Doch den Überlieferungen nach waren die Schildbürger ursprünglich sogar besonders kluge Leute – denen ihr Scharfsinn schließlich zum Verhängnis wurde. So wurden sie anfangs gerne als Berater an Fürstenhäuser in der ganzen Welt gerufen, bis die Schildbürgerinnen aufbegehrten: Während ihre Männer in der Weltgeschichte umherzogen, waren sie bei der Feldarbeit ganz auf sich alleine gestellt. Haus und Hof verwahrlosten.
In einer Ratsversammlung beschlossen die Schildbürger deshalb, sich ab sofort dumm zu stellen. Unter diesen Umständen würde sie kein Herrscher mehr als Ratgeber haben wollen. Der anfangs so gerissene Plan hatte nur einen Haken: Die Schildbürger hatten nicht mit den Langzeitfolgen ihrer selbst auferlegten Torheit gerechnet. Allmählich, so die Sage, wurden sie damit wirklich zu Dummköpfen.
Unklar ist heute, ob eine real existierende Stadt Vorbild für die Erzählungen war – und wenn ja, welche. Manche Heimatforscher vermuten, dass Schildau in Sachsen die Hochburg der närrischen Bürger ist. Die Stadt wird im Volksmund Schilde genannt und in der ersten Ausgabe des Buches ist ebenfalls nicht von „Schilda“, sondern „Schilde“ die Rede. Doch neben Schildau gibt es noch ein halbes Dutzend anderer Orte, auf die die Erzählungen theoretisch zurückgehen könnten.
Das Schildbürgerbuch selbst liefert aber noch eine weitere mögliche Erklärung, wie die Schildbürger zu ihrem Namen kamen. Demnach stammt er von der Bezeichnung „Schilt“, was so viel bedeutet wie „Wappen”. Wappen sind eigentlich Insignien des Adels. Trotzdem beharrten die bürgerlichen Helden des Buches auf ihr Zeichen und entwarfen Phantasie-Wappen. Folglich wohnten die Bürger in einem Ort namens „Schilde“ oder, wie es im Buch auch manchmal heißt, „Schiltburg“.
Eine Verbindung in die Antike?
Das Schildbürgerbuch ist nicht nur ein Konglomerat aus verschiedenen Erzählungen. Es ist vor allem auch eine Art Weiterführung oder Neuauflage des sogenannten Lalebuchs. Dieses Werk erschien 1597, ein Jahr vor dem Schildbürgerbuch. Entsprechend heißen seine Protagonisten Lalen und wohnen in Laleburg. Der Rest stimmt mit dem Schildbürgerbuch weitgehend überein.
Das Schildbürgerbuch ist deswegen aber nicht ein früher Fall von Plagiat. Wie der Autor des Schildbürgerbuchs ist auch der des Lalebuchs unbekannt. Im Mittelalter ging es weniger um Urheberrechte als vielmehr um den Buchinhalt selbst. Die Tradition der Überlieferung machte ein Werk erst wertvoll. Teilweise reichten die Wurzeln der Erzählungen mit fabelhaftem Charakter, ganz gleich ob niedergeschrieben oder mündlich überliefert, zurück bis in die Antike.
Tatsächlich haben viele der Schildbürgergeschichten ihren Ursprung in der Fabeldichtung des griechischen Dichters Äsop. So auch die Geschichte von einem ausgelassenen Gelage, das in einem heillosen Chaos endet: Dabei verlieren die betrunkenen Schildbürger während des Festes jegliche Kontrolle. Ihre Gliedmaßen verknoten sich zu einem einzigen Gewirr. Erst ein vorbeikommender Fremder löst die prekäre Situation.
Mit einem Knüppel schlägt er auf die Beine der Schildbürger ein, der Schmerz findet den dazugehörenden Körper und befreit die Tölpel schließlich aus ihrer misslichen Lage. Eine ähnliche Geschichte hat schon Äsop im 6. Jahrhundert vor Christus erzählt. Die Mär vom menschlichen Knäul verurteilte den ungezügelten Genuss von Alkohol. Bereits Äsops Werke nahmen menschliche Schwächen aufs Korn. Neid, Geiz, Eitelkeit oder Dummheit waren stets Motive, die er metaphorisch verpackte.
Bestseller aus dem Mittelalter
In einem weiteren Streich finden die Schildbürger ein seltsames Geschöpf in ihrer Stadt. Nie zuvor haben sie ein solches Tier gesehen. Lange rätseln sie über seine Art und Herkunft. Einziger Anhaltspunkt ist für sie das große Scherenpaar am Ende seiner vorderen Beine. Daraus folgern sie, dass es sich um einen Schneider handeln muss. Und natürlich, so glauben sie, braucht ein Schneider einen Stoff zum Schneidern. Daraufhin setzten sie den Krebs auf ein Tuch, in der Hoffnung, der seltsame Fremde möge ihnen sein Anliegen über ein Schnittmuster vermitteln.
Freilich irrt das Tier nur hilflos über das Garn, während die Scheren der Schildbürger hinterher sausen. Das feine Tuch ist danach ruiniert. Die Enttäuschung der Schildbürger ist groß. Sie beschimpfen den Krebs als Betrüger. Dabei kommt ein Schildbürger dem Tier zu nahe. Das Krabbeltier schnappt nach seinem Finger. Sofort wird der Krebs als Mörder angeklagt und zum Tode verurteilt. Doch da die Schildbürger keine Ahnung haben, wen sie vor sich haben, wollen sie den falschen Schneider ertränken und entlassen den armen Krebs in seine natürliche Umgebung.
Auch mit diesem Streich werden gesellschaftliche Missstände auf den Arm genommen. In diesem Fall steht die Rechtsprechung am Pranger. Das Gefühl der Willkür und die Zweifel am Verstand der Obrigkeit beschäftigten die Menschen in der Antike und im Mittelalter genauso wie heute. Möglicherweise wurde das Schildbürgerbuch gerade wegen dieser Alltagsnähe zum Bestseller – und das Schicksal der Helden zum Inbegriff für Bürokratie-Irrsinn.