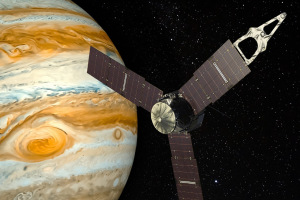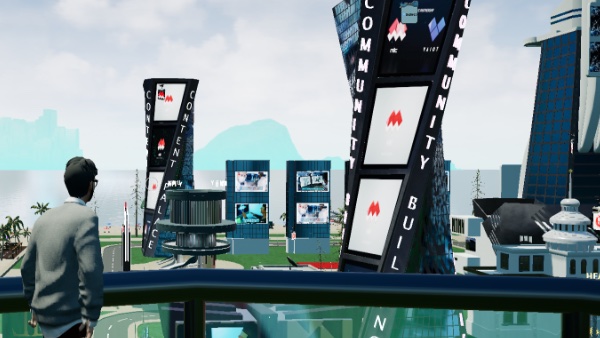Altokumuluswolken, auch Schäfchenwolken genannt, schweben in Bereichen zwischen zwei und sechs Kilometern über der Erdoberfläche und setzen sich aus mehreren Schichten oder Federn zusammen.

Wolken sind Ansammlungen sehr feiner Wassertröpfchen – also Nebel – oder Eiskristallen in der Atmosphäre. Die Vielfalt ihrer Formen und Farben scheint grenzenlos. Die auf dem Bild zu sehenden beulenförmigen Mammatuswolken bilden sich meist am Rand von Gewitterfronten. Am eindrucksvollsten sind sie in Äquatornähe zu beobachten.

Die linsenförmige Wolkenart Lenticularis ist häufig in der Nähe von Bergen zu finden. Oft sind sie bei Föhnwetter zu sehen und können sich in mehreren Schichten überlagern.

Cirruswolken finden sich zwischen 10.000 und 13.500 Meter Höhe über der Erdoberfläche. Sie bestehen aus Eiskristallen und stehen in Hochdruckgebieten häufig als Schönwetterwolken am Himmel.

Exotisches Himmelsschauspiel: Perlmutterwolken treten im polaren Winter der Antarktis und Arktis, 22 bis 29 Kilometer hoch in der Stratosphäre auf. Bestimmte Kaltluftgebiete, die sogenannten Polarwirbel, sind Voraussetzung für ihre Entstehung. Sie bestehen aus unzähligen Eiskristallen und bieten ein eindrucksvolles, schillerndes Farbenspiel. Das liegt daran, dass die unterschiedlich großen Kristalle das Sonnenlicht in jeweils anderen Winkeln brechen.

An der Oberseite von Cumulonimbuswolken, auch Ambosswolken genannt, herrscht thermisches Gleichgewicht. Von unten nachströmende Luft kann sich nur seitwärts ausbreiten. Die massigen Wolkengebirge bringen Niederschläge aller Art mit sich – Regen, Graupel, Hagel oder Schnee – und häufig auch Gewitter.

Zwischen 20 und 30 Millionen Blitze produzieren die Wolken in der Erdatmosphäre – und zwar jeden Tag. Während eines Gewitters tritt ein Blitz als Folge elektrostatischer Aufladung der Wassertröpfchen auf, aus denen die Wolken bestehen. Am häufigsten sind Blitze zwischen Cumulonimbus-Wolken und der Erde zu beobachten. Obwohl bereits im 18. Jahrhundert bewiesen werden konnte, dass bei Gewittern eine elektrische Spannung zwischen Wolken und Erde besteht, ist bis heute nicht hundertprozentig geklärt, wie der Starkstrom aus den Wolken genau ausgelöst wird.

Sturmjäger fühlen sich scheinbar geradezu magisch zum Unwetter hingezogen, viele von ihnen wagen sich bis ins Zentrum von Wirbelstürmen hinein. Sie fürchten weder Superzellen noch Tornados. Je spektakulärer die Formationen erscheinen, die sich am Firmament zusammenbrauen, desto besser ...

Aus dieser Superzelle heraus hat sich ein Tornado entwickelt, der über die Stadt Memphis (US-Bundesstaat Tennessee) hinwegzieht. Die Wirbelstürme erreichen Windgeschwindigkeiten von bis zu 500 Stundenkilometern. Nicht nur an Land sind sie gefürchtet, sondern auch über dem Meer. Hier werden sie Wasserhosen genannt und können selbst schwere Boote zum Kentern bringen.

Stratocumulus-Wolken, auch Haufenschichtwolken genannt, bestehen aus Wasser und Schneekristallen. Niederschlag fällt aus ihnen eher selten. Sie sind die in Mitteleuropa am häufigsten auftretende Wolkenart.

TEXT

TEXT

Eine durchschnittliche Cumulus- oder Schönwetterwolke wiegt zwischen fünf und zehn Tonnen – bei einem Kilometer Höhe und hundert mal hundert Metern Umfang. Eine prall gefüllte Regenwolke mit den gleichen Ausmaßen brächte dagegen bis zu 300 Tonnen auf die Waage.

Eine durchschnittliche Cumulus- oder Schönwetterwolke wiegt zwischen fünf und zehn Tonnen – bei einem Kilometer Höhe und hundert mal hundert Metern Umfang. Eine prall gefüllte Regenwolke mit den gleichen Ausmaßen brächte dagegen bis zu 300 Tonnen auf die Waage.

Trotz modernster Technik können kein Computer und kein Mensch genau vorhersagen, welche Wolkenformationen tatsächlich zu einem bestimmten Zeitpunkt über einem bestimmten Ort zu sehen sein werden.

Mit Sicherheit wird die Klimaforschung noch zahlreiche neue und überraschende Fakten über die Wolken herausfinden. Viele Fragen über die abstrakten und vergänglichen Himmelsgebilde sind offen. Sie werden uns auch in Zukunft beim Blick zum Himmel immer wieder mit auf ihre rätselhafte Reise um die Erde nehmen.
Sie sind immer in Bewegung. Unbeständig, vergänglich und stets einzigartig ziehen die Wolken hoch über unserem Planeten umher. Genau wie zwei Drittel der Erdoberfläche mit dem Wasser der Ozeane bedeckt sind, so sind auch stets etwa zwei Drittel der Erde von Wolken verhangen.
Zu allen Zeiten waren die Menschen fasziniert vom Form- und Farbspiel der flüchtigen Gebilde: Landschaftsmaler, Künstler und Träumer versuchten, sie in ihren Werken festzuhalten. Doch für Wissenschaftler blieben die Wolken lange ein großes Rätsel – eben weil sie so dynamisch, wandelbar und weit entfernt sind.
Tatsächlich gehören Wolken zu den komplexesten Erscheinungen, die in der Natur überhaupt zu finden sind. Auch heute noch stehen Forscher vor zahlreichen unbeantworteten Fragen. Besonders im Hinblick auf die globale Erwärmung gilt ihnen aktuell das gesteigerte Interesse der Klimaforschung. Weil sie den größten Unsicherheitsfaktor innerhalb aktueller Klimamodelle darstellen, widmete der Weltklimarat (IPCC) den Wolken sogar ein eigenes Kapitel in seinem Ende 2013 veröffentlichten Bericht.
Wie Wolken entstehen und was in ihnen steckt
Doch was sind eigentlich Wolken? Kurz gesagt handelt es sich um Ansammlungen winzig kleiner Wassertröpfchen, kleiner als ein hundertstel Millimeter. In Regenwolken sind diese allerdings deutlich größer als in Schönwetterformationen. Die in den Wolken gebündelten Wassertröpfchen bilden sich um Kondensationskerne in der Luft – entweder, wenn warme Luft aufsteigt oder wenn sich warme Luftschichten über kältere schieben. Schnee- und Eiskristalle oder gar Hagelkörner entstehen bei großer Kälte und in besonders hohen Luftschichten. Hinzu kommen außerdem Staubpartikel und Teilchen aus Abgasen oder Rauch.
Die Anfänge der Wolkenforschung
Die Farbe der Wolken hängt in erster Linie von derjenigen des einfallenden Lichts ab. Sie verteilen sich über mehrere Stockwerke um die Erde, in niedriger, mittelhoher und großer Höhe. Nach Schätzungen zirkulieren um die 13 Billiarden Liter Wasser in der Atmosphäre – fast 300-mal so viel wie im Bodensee. Innerhalb von zehn Tagen tauscht es sich durch Niederschlag und Verdunstung einmal komplett aus.
Der von der Weltorganisation für Meteorologie herausgegebene, erstmals 1896 erschienene „Internationale Wolkenatlas“ teilt die Wolken in unterschiedliche Gattungen, Arten und Unterarten ein: Nach Kriterien wie Helligkeit, Farbe, Größe und räumlicher Erscheinung unterscheiden Wolkenforscher zehn Hauptgruppen und mehr als 200 unterschiedliche Wolkentypen.
Als Begründer der Wolkenforschung, auch Nephologie genannt, gilt der Apotheker und Naturforscher Luke Howard: Er teilte Wolken erstmals wissenschaftlich in Kategorien ein. Seine Veröffentlichung „On The Modification of Clouds“ („Über die Wandelbarkeit der Wolken“) von 1802 gilt als Schlüsselwerk der Wolkenforschung.
Wolken verstehen mit Computermodellen
Heute wollen Klimaforscher wissen, wie groß der Einfluss der Wolken auf den Strahlungshaushalt der Erde – und damit auf das Klima – ist. Mit den bisherigen Computermodellen zum Klimawandel ist es schwierig, die künftige Wolkenbildung und Niederschlagsverteilung darzustellen. Die Unsicherheit bisheriger Modellaussagen beziffern die Forscher auf rund 50 Prozent. Bislang sind die genauen Vorgänge in der Atmosphäre einfach noch zu unbekannt.
Mehr als 120 Forscher aus 17 Instituten arbeiten in Deutschland an besseren Modellen für die Wolken- und Niederschlagsbildung. Ihr Ziel: Treffsichere Aussagen zur Entwicklung der Niederschläge in einzelnen Regionen. Die mit neuen Modellen gewonnenen Erkenntnisse könnten in die nächsten Berichte zum Erdklima einfließen. Doch ob jemals alle Rätsel, die die Wolken in sich bergen, gelöst werden, ist fraglich. Bei allem wissenschaftlichen Interesse bleiben die geheimnisvollen Formationen am Himmel auch immer Objekte der Fantasie und der Faszination.