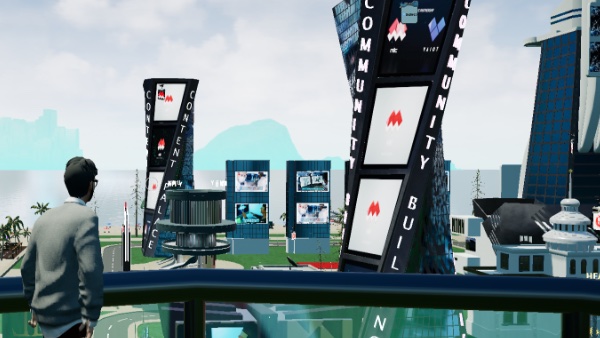Weltweit sind rund 140 Millionen Menschen alkoholabhängig, schätzt die Weltgesundheitsorganisation WHO. Auch in Deutschland sollen es zwischen 1,3 und 2,5 Millionen sein. Und viele weitere sind gefährdet – denn Alkohol gehört zu vielen Anlässen dazu, und nicht jedem fällt es leicht, Bier, Wein oder Schnaps nur in Maßen zu genießen. Doch woran erkennt man, ob sich jemand noch im grünen Bereich bewegt oder bereits krank ist?
Generell gilt: Männer sollten nicht mehr als 24 Gramm reinen Alkohol pro Tag trinken, Frauen nicht mehr als zwölf Gramm. 24 Gramm entsprechen etwa 0,2 Litern Wein oder Sekt, einem halben Liter Bier oder acht Zentilitern Schnaps. Wer mehr Alkohol zu sich nimmt, verlässt den risikoarmen Bereich und sollte sein eigenes Verhalten – oder das von Freunden oder Familienmitgliedern – aufmerksam beobachten.
Das Verhalten im Alltag
Erstes Alarmzeichen: Der häufige Wunsch, Alkohol zu trinken. Viele Betroffenen nehmen sich vor, nur ein oder zwei Bier zu trinken – doch bereits nach den ersten Schlucken entsteht das unwiderstehliche Bedürfnis, mehr Alkohol zu sich zu nehmen, sie verlieren die Kontrolle über ihr Trinkverhalten. Dies bedeutet nicht, dass die Alkoholgefährdete permanent trinken müssen. Doch haben sie einmal begonnen, ist ein Aufhören meist erst dann möglich, wenn der Körper streikt. Mehrtägige, manchmal auch mehrmonatige Pausen können eingelegt werden, doch fällt der Trinker immer wieder in dieses Muster zurück. Mit der Zeit vertragen die Personen immer mehr Alkohol, so dass auch die Trinkmenge steigt.
Häufig erfindet die betroffene Person auch Ausreden dafür, warum sie sich betrinkt. Und obwohl die Selbstachtung sinkt, tritt der Trinker in der Öffentlichkeit mit großer Selbstsicherheit auf, um dies zu kompensieren. Er reagiert oftmals aggressiv und isoliert sich von seiner Umwelt. Um nicht negativ aufzufallen, stellen alkoholgefährdete Menschen für sich oft Regeln auf, ab welcher Tageszeit und an welchen Orten sie trinken.
Potentielle Alkoholiker meiden immer mehr Tätigkeiten, die sie am Trinken hindern könnten. Auch werden Hobbys und andere Freizeitaktivitäten vernachlässigt, weil die Betroffenen unter den Folgen ihres Konsums leiden. Stimmungsschwankungen, Schuldgefühle und Depressionen kommen hinzu, auch körperliche Symptome wie morgendliche Übelkeit und Magenschmerzen. Doch obwohl die Betroffenen wissen, dass ihnen der Alkoholkonsum nicht gut tut, können sie nicht aufhören.
Alkoholismus bei Jugendlichen
Jugendliche, die noch im Elternhaus wohnen, stehlen oftmals Schnaps oder anderen Alkohol bei den Eltern und füllen, um dies zu verbergen, die Flaschen wieder mit Wasser auf. Zu erkennen ist ihr Alkoholkonsum auch an geweiteten Pupillen, glasigen Augen und roten Backen. Da es sich bei Alkohol um eine weit verbreitete Jugenddroge handelt, ist die Grenze zwischen gelegentlichem und regelmäßigem Konsum schwer zu ziehen. Wenn jedoch festzustellen ist, dass zwischen dem Trinken nur noch kurze Unterbrechungen liegen, nach dem ersten Schluck dauerhaft bis zum Einschlafen konsumiert wird oder bereits am Morgen Alkohol getrunken wird, dann muss man von Alkoholismus ausgehen.
Viele Betroffene wissen insgeheim selbst, dass sie ein Problem haben, reagieren aber aggressiv und ablehnend, wenn sie darauf angesprochen werden. Deshalb ist ein vorsichtiges Gespräch ohne Vorwürfe und Abwertung meist ein guter Weg. Anlaufstellen und Hilfe, auch bei der Suche nach einer geeigneten Therapie, gibt es in fast jeder Stadt.