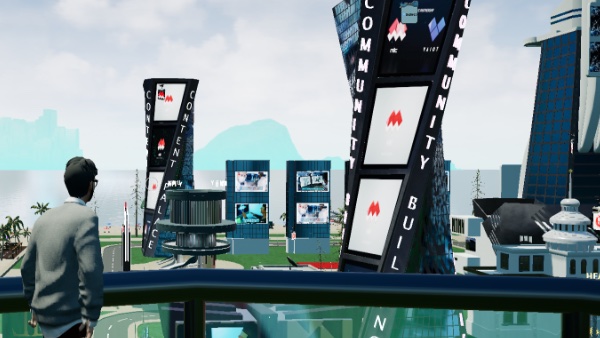Dieser Beitrag ist auch verfügbar auf:
English
Wir sind unter Tage, im Lefdal Mine Datacenter in der Nähe des Dorfs Kjølsdalen in der Provinz Vestland in Norwegen. Die Umgebung sieht aus wie ein Filmset im Finale eines James-Bond-Thrillers. Stimmungsvoll grün angestrahlte Gesteinswände schimmern in der Ferne, Metalltreppen führen in wohnzimmergroße Module voller Hochleistungs-IT-Equipment. In den Gängen dazwischen herrscht emsiges Treiben. Bauarbeiter transportieren Materialien, Techniker installieren neue Systeme.
Dazwischen schlängelt sich im Schritttempo unser Wagen hindurch und kommt schließlich zum Stehen. Wir steigen aus, mit Sicherheitsjacken und Sturzhelmen ausgestattet – schließlich befinden wir uns in einem ehemaligen Bergwerk. Durch das Sicherheitsglas können wir ihn bereits sehen: „Olivia“, den leistungsfähigsten Supercomputer Norwegens. Dieser wurde in einer Zusammenarbeit von AMD und Hewlett Packard Enterprise konstruiert. AMD lieferte die Hochleistungs-Computerchips, Hewlett Packard Enterprise übernahm den Rest der Konstruktion.
Was ist ein Supercomputer?
Supercomputer sind von Grund auf für eine möglichst hohe Rechenleistung ausgelegt. Sie werden üblicherweise von Forschungseinrichtungen und Universitäten genutzt und enthalten Hochleistungsbauteile, die eine Serienfertigung zu aufwendig und zu teuer machen. Für aufwendige Berechnungen können Supercomputer bis zu eine Million Mal schneller sein als Computer für den Heimgebrauch. Supercomputer bestehen üblicherweise aus einer großen Anzahl miteinander vernetzter Computereinheiten, die wiederum mehrere Prozessoren enthalten. Diese werden Knoten genannt, der englische Begriff ist „Nodes“.
Was „Olivia“ alles kann
Von solchen Knoten besitzt „Olivia“ gleich 252, ausgestattet mit zwei Prozessoren vom Typ AMD Turin Epyc 9745. Jeder dieser Prozessoren besitzt wiederum 128 Kerne, die es erlauben, zahlreiche Rechenvorgänge gleichzeitig durchzuführen. Da „Olivia“ mit insgesamt 504 Prozessoren ausgestattet ist, ergibt dies zusammen 64,512 Kerne.
Zudem ist Olivia konsequent auf die KI-Zukunft ausgelegt und enthält 304 GPUs (Grafikprozessoren) vom Typ Nvidia GH200. GPUs haben die Fähigkeit, möglichst viele parallele Rechenoperationen zeitgleich auszuführen. Hiermit kommen sie der Struktur künstlicher neuronaler Netze entgegen, auf denen zahlreiche KI-Modelle basieren – auch der bisherige Branchenprimus ChatGPT.
17 Mal so schnell wie der Vorgänger
Den bisherigen Tests zufolge kann „Olivia“ Rechenoperationen doppelt so schnell erledigen wie sein „Betzy“ genannter Vorgänger. Und das, obwohl sich „Olivia“ noch in seiner Pilotphase befindet. Was jedoch am beeindruckendsten ist: „Olivia“ besteht aus nur zwei Server-Racks und ist damit ungefähr so groß wie ein handelsüblicher Kleiderschrank. „Betzy“ dagegen benötigt ganze 16 Server-Racks und nimmt somit etwa so viel Platz in Anspruch wie ein komplettes Wohnzimmer. „Olivia“ ist also nicht nur der schnellste, sondern der kompakteste Supercomputer Norwegens. Auf lange Sicht soll er das 17-Fache der Rechenleistung von „Betzy“ erreichen.
Wie „Olivia“ beim Kampf gegen den Klimawandel helfen wird
Computergenerierte Klimamodelle berechnen, wie sich das Klima unter verschiedenen Bedingungen entwickeln kann. Sie basieren auf über Jahrzehnte erhobenen Klimadaten und machen die Folgen des Klimawandels sichtbar. Hierdurch liefern sie wichtige Entscheidungsgrundlagen, um wirksame Klimaschutzmaßnahmen zu planen.
Eines der wichtigsten Einsatzgebiete der Rechenkraft von „Olivia“ für die Forschung wird das NorESM (Norwegian Earth System Model) sein. Dieses simuliert unter anderem Wind, Temperatur, Niederschlag sowie die Dichte von Wolken in der Atmosphäre. Hierzu kommen Temperatur, Salzgehalt und Strömungen im Ozean sowie Vegetation, Bodentemperatur und Bodenfeuchtigkeit an Land. Dank „Olivia“s hoher KI-Rechenleistung rechnen Norwegens Klimaforscher damit, in Zukunft noch schnellere und akkuratere Prognosen treffen zu können. „Olivia“ wird diesen Herbst online gehen und norwegischen Forschern und Wissenschaftlern über die staatlichen Dienste Sigma2 und Norwegian Research Infrastructure Services (NRIS) zur Verfügung stehen.
Das Lefdal Mine Datacenter: Kooperation mit Mercedes-Benz, Weiterleitung von erhitztem Wasser an Lachsfarmen und mehr
Das verlassene Bergwerk wurde mit Bedacht als Standort gewählt, da es eine ressourcenschonende Konstruktion mit einem hohen Sicherheitsniveau verbindet. Der 500 Meter lange und 160 Meter tiefe Untergrundkomplex besteht aus fünf Ebenen. Wie uns verraten wurde, werden diese jedoch nicht nur für Rechenzentren genutzt. So führt beispielsweise Mercedes-Benz hier Crashtests für seine Automodelle durch. Zudem sind weitere, noch geheime Projekte in Planung.
Zum Betrieb des Lefdal Mine Datacenter kommen direkt in der Nähe gewonnene erneuerbare Energien wie Wind- und Solarenergie zum Einsatz. Dies minimiert Transportverluste des Stroms, die durch lange Stromleitungen entstehen können. Zur Kühlung der installierten Systeme kommt das Wasser des angrenzenden Fjords zum Einsatz. Dieses leitet in aufwendigen Direct-Liquid-Cooling-Systemen die Abwärme der Rechner nach außen ab – ohne die Komponenten der Rechner je direkt zu berühren.
Das Wasser, das das Rechenzentrum verlässt, wird durch diesen Prozess leicht erwärmt. Das Rechenzentrum plant aktuell, das erwärmte Wasser zu einer in der Nähe gelegenen Lachsfarm des Lebensmittelherstellers Sjømatstaden weiterzuleiten, um den Zuchtprozess zu optimieren. Das Lefdal Mine Datacenter ist ein privates Unternehmen. Dieses gehört zum Teil dem deutschen Unternehmen Rittal, einem Hersteller von Schaltschränken, Stromverteilungen, Klimatisierungen sowie der auf dessen Systemen laufenden Software.
Es geht sehr wohl ohne fossile Energien
Das Lefdal Mine Datacenter hat sich aktuell zum Ziel gesetzt, das umweltfreundlichste Rechenzentrum der Welt zu werden. Kritische Stimmen dürften nun anmerken, dass sich der norwegische Staat selbst ein Beispiel daran nehmen sollte. Einerseits präsentiert die norwegische Regierung das skandinavische Königreich gerne als grünes Paradeland, dessen Energiebedarf zu 90 Prozent aus erneuerbaren Quellen stammt. Andererseits ist Norwegen weiterhin einer der größten Lieferanten fossiler Energien weltweit. Für seine Unwilligkeit, dies zu ändern, wurde das Land bereits mit einigem Gegenwind konfrontiert.

Der Standort von „Olivia“, vom ehemaligen Bergwerk aus gesehen. Über dem Serverraum befindet sich ein Meeting-Raum.

Die kompakten Serverracks von „Olivia“, vom Bergwerk aus gesehen.

„Olivia” im Serverraum. Der eigentliche Supercomputer sind die linken zwei Racks. Die restlichen zwei Racks sind für die Datenspeicherung und Kühlung bestimmt.

Die „Epyx“-Supercomputer-Chips von AMD im Größenvergleich zu einem AMD-Ryzen-Chip für Verbraucher.

Weitere Impressionen des ehemaligen Bergwerks, rechts einige der modularen Rechenzentren.

Ein Gruppenfoto aller Besucher, gemeinsam mit einigen Mitarbeitern von AMD, Hewlett Packard sowie des Lefdal Mine Datacenters.