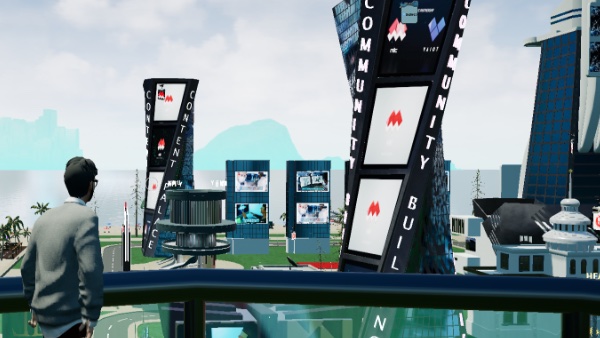„Iiiihh! Da ist ja eine Made im Salat!“ Beim Blick auf den Teller verzerrt sich das Gesicht. Sofort weicht der Appetit dem Gefühl von Ekel. Nichts Ungewöhnliches, sondern gesunder Reflex: Ekel signalisiert uns, dass wir die Maden-Mahlzeit besser nicht anrühren sollten.
Schon unsere Vorfahren hat dieses Gefühl vor Vergiftungen und Erkrankungen bewahrt. Doch allein damit lässt sich das Phänomen noch nicht ausreichend erklären. Schließlich ekeln sich Menschen aus verschiedenen Kulturen vor unterschiedlichen Dingen. Warum ist das so?
Ekel als unwillkürliche Reaktion
Die Fähigkeit zum Ekel ist uns angeboren. Kot, Körperflüssigkeiten, eitrige Wunden, Verdorbenes und Verfaultes stufen Menschen weltweit als ekelerregend ein – das hat eine Studie der London School of Hygiene and Tropical Medicine gezeigt. Dazu waren 40.000 Menschen rund um den Globus gefragt worden, wovor sie sich ekeln. Das Ergebnis zeigt, dass wir Gesundheitsgefährdendes eher als ekelerregend einschätzen als harmlose Dinge.
Ekel schützt damit vor Vergiftung, Verunreinigung und der Ansteckung mit Krankheiten. Das erklärt auch, warum Ekel so viel mit Geruch und Geschmack zu tun hat: Er soll verhindern, dass wir etwas Verdorbenes zu uns nehmen oder auch nur berühren. Riechen oder schmecken wir Vergammeltes, wird uns übel, der Ekel lässt uns würgen oder sogar erbrechen – ein genetisch verankertes Schutzprogramm.
Doch warum ekeln wir uns auch vor Dingen, die überhaupt nicht giftig sind? Etwa vor Würmern, Ameisen oder Schlangenhaut? Die Abneigung gegen bestimmte Dinge wird auch von der Kultur beeinflusst. Das lässt sich zum Beispiel gut bei den Essgewohnheiten beobachten. Was bei Mitteleuropäern Würgereize auslöst, wird in anderen Ländern als Delikatesse geschätzt: So sind rohe Eier, einige Wochen alt und fermentiert, eine Leibspeise der Chinesen.
Sie sind definitiv ungiftig – eigentlich also kein Grund sich zu ekeln. Doch Tests haben gezeigt, dass Europäer kurz davor stehen, sich zu übergeben, wenn sie in das glibbrige Etwas beißen müssen. Umgekehrt ekeln sich Asiaten, wenn sie mit Gaumenfreuden wie französischem Blauschimmelkäse konfrontiert werden.
Was den einen ekelt, stört den anderen nicht
Dies zeigt auch, wie sehr Ekel im Laufe des Lebens durch verschiedene Erfahrung, durch unsere Umwelt sowie Sozialisation entwickelt wird. Mit der Fähigkeit, uns zu ekeln, werden wir geboren, doch wovor wir uns ekeln, ist auch das Ergebnis unserer Erziehung. So ist etwa der Ekel vor natürlichen Ausscheidungen sehr stark, jedoch nicht angeboren. Die Mutter gibt ihren Abscheu vor Fäkalien vielmehr an ihr Kind weiter.
Und weil sich Erziehung und Kultur ständig verändern, ändert sich auch unser Ekel. Wir finden unter anderem starke Körperbehaarung abstoßend, etwa an Frauenbeinen oder unter den Achseln. Doch noch vor wenigen Jahrzehnten hatte man mit Achselflaum kein Problem. Viele finden heutzutage auch das Kuscheln mit der Hausratte völlig normal – unsere Großeltern würden sich da angewidert abwenden.